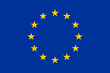Was ist zu erwarten? Die Zukunft der Impfstoffentwicklung
Die Impfstoffforschung entwickelt sich stetig weiter und setzt neue Technologien ein, um die Auswirkungen verschiedener Krankheiten zu reduzieren oder sie ganz aus unserer Gesellschaft zu verbannen.
Seit der Entwicklung des ersten Impfstoffs im Jahr 1796 suchen Forschende nach neuen Wegen, um Menschen durch Impfungen vor Infektionskrankheiten zu schützen. Während einige tödliche oder schwerwiegende Krankheiten mittlerweile vollständig durch Impfungen verhindert werden können, sterben Jahr für Jahr immer noch Tausende von Menschen weltweit an anderen Krankheiten, beispielsweise Malaria. Die Entwicklung neuer Impfstoffe sowie der Zugang zu vorhandenen Impfstoffen bleiben daher nach wie vor eine Priorität im Bereich der öffentlichen Gesundheit.
Mittlerweile stehen sechs Impfstofftechnologien – oder -Plattformen – der Impfstoffentwicklung zur Verfügung. Zu den vielversprechendsten Fortschritten in der Impfstofftechnologie zählen mRNA- und DNA-Impfstoffe. Diese Technologien haben das Potenzial, bahnbrechende Fortschritte zu erzielen, die über die Bekämpfung von Infektionskrankheiten hinausreichen, etwa bei der Prävention oder Behandlung bestimmter Krebsarten.
mRNA-Impfstoffe
Die Technologie der Messenger-RNA (mRNA) wird seit den 1960er Jahren entwickelt und erforscht. Die ersten Studien mit mRNA-Impfstoffen untersuchten, wie diese Technologie zur Verhütung von Ebola eingesetzt werden kann. Mit der COVID-19-Pandemie verlagerten sich diese frühen Bemühungen auf COVID-19. Im Jahr 2020 wurde der erste mRNA-Impfstoff in Europa zur Anwendung gegen COVID-19 zugelassen.
Die mRNA-Technologie wurde auch in klinischen Studien gegen andere Infektionskrankheiten wie Grippe, RSV und ZIKA getestet.
Seit den 1970er-Jahren wird die mRNA-Technologie für die Entwicklung von Impfstoffen gegen bestimmte Krebsarten, darunter schwarzer Hautkrebs und Lungenkrebs, sowie für neuartige Krebstherapien erforscht. Die Technologie hat Durchbrüche in der Forschung ermöglicht, um das Wiederauftreten aggressiver Krebserkrankungen nach einem chirurgischen Eingriff zu verhindern und den Körper dazu anzuleiten, bestimmte Krebsarten zu bekämpfen, bevor sie wachsen können.
DNA-Impfstoffe
DNA-Impfstoffe, auch bekannt als Plasmid-Impfstoffe , bringen kurze DNA-Sequenzen in den Körper ein, die die Informationen zur Produktion von Antigenen eines bestimmten Virus oder einer bestimmten Bakterienart liefern. Nachdem der Impfstoff im Körper ist, wird die DNA-Sequenz von den körpereigenen Zellen dazu benutzt, Antigene zu bilden. Auf diese Weise kann unser Immunsystem lernen, die Krankheit zu erkennen und zu bekämpfen, sollte es später mit ihr in Kontakt kommen.
Einer der möglichen Vorteile dieses Ansatzes besteht darin, dass die Reaktion des Immunsystems viel stärker ausfallen kann als bei anderen Arten von Impfstoffen. DNA-Impfstoffe sind darüber hinaus einfacher herzustellen und stabiler als mRNA-Impfstoffe, da sie nicht bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt aufbewahrt werden müssen, was den Zugang erheblich verbessern würde.
Das Potenzial von DNA-Impfstoffen wurde erstmals in den 1980er Jahren entdeckt. DNA-Impfstoffe werden derzeit noch erforscht, und sind in der EU/im EWR bislang noch nicht zur Anwendung beim Menschen zugelassen. Weltweit werden klinische Studien durchgeführt, um deren Sicherheit und Wirksamkeit gegen verschiedene Infektionskrankheiten zu untersuchen. Erstmals wurden DNA-Impfstoffe 1993 bei Tieren eingesetzt und erhielten in den Vereinigten Staaten und der EU/EWR eine Zulassung zur Anwendung bei Tieren. Der erste DNA-Impfstoff zur Anwendung beim Menschen wurde 2021 in Indien zum Schutz vor COVID-19 zugelassen DNA-Impfstoffe haben das Potenzial, eine Vielzahl neuer Anwendungsmöglichkeiten zu eröffnen, einschließlich der Entwicklung eines Impfstoffes gegen HIV und gegen weitere Erkrankungen.
Wie bei allen Impfstoffen und anderen Arzneimitteln in Europa muss für DNA-Impfstoffe nachgewiesen werden, dass sie sicher und wirksam sind, bevor sie zur Anwendung beim Menschen zugelassen werden.
Neue Wege der Verabreichung von Impfstoffen
Obwohl Impfstoffe sicher, wirksam und kostengünstig sind, kann die Verabreichung mit Nadeln, insbesondere Kinder, abschrecken. Aktuell wird viel Forschung betrieben, um neue Wege zur Impfstoffverabreichung zu entwickeln. Hier einige Beispiele: